Zu den Gräbern berühmter Eintrachtler
Donnerstag 28.8.2025Am Donnerstag, dem achtundzwanzigsten August, hatte der Regen endlich aufgehört. Ein matter Glanz lag über dem Frankfurter Hauptfriedhof, und aus den hohen Kronen der alten Bäume tropfte es noch vereinzelt, als halte die Natur an ihrem Klagelied fest. Die Luft war schwer von Feuchtigkeit und von jenem eigenartigen Duft nach Erde, Stein und Laub, der den großen Friedhöfen eigen ist – ein Geruch der Vergänglichkeit, doch auch der Beharrung.
Die Wege glänzten dunkel, und dazwischen erhoben sich Monumente, deren Formen über bloße Gräber hinauswiesen. Hier war nicht nur vom Tod die Rede, sondern von einem vergangenen Selbstverständnis, das sich im Stein zu behaupten suchte.
Unter den hohen Bäumen sammelte sich eine kleine Gruppe der „Adler Classics“, die an diesem Nachmittag dem Vergangenen ihre Aufmerksamkeit widmen wollte. Einer den jeder kannte, führte die anderen – ein Kenner der Geschichte der Eintracht, der mit leiser Geste und stiller Sachkenntnis den Pfad durch das Reich der Erinnerung wies, Matze – der Leiter des Eintracht Museums. Der Friedhof, so schien es, war ihm vertraut wie ein altes Buch, dessen Seiten er immer wieder aufschlägt, um darin die Gesichter seiner Helden zu finden.
Während sich der Zug in Bewegung setzte, sank eine sanfte Ruhe über die Wege. Die Luft war mild geworden, und in den Pfützen spiegelte sich ein Himmel, der seine Trauer längst verinnerlicht hatte. Es war ein geeigneter Tag, um von jenen zu hören, die einst das Leben mit solcher Inbrunst geführt hatten, dass selbst der Tod sie nicht zum Schweigen bringen konnte.

Ilse Bechthold (18.11.1927 – 17.5. 2021)
Das Grab lag an einem stillen Seitenweg. Der Stein war hell, das Moos zurückhaltend; nichts wollte hier auffallen. Doch in der Schlichtheit lag eine Würde, die sich dem Blick erst allmählich erschloss.
Ilse Bechthold war eine jener Gestalten, deren Leben sich zwischen Entbehrung und Tatkraft spannte. In den Jahren des Krieges, inmitten von Zerstörung und Verlust, hatte sie erfahren, was es heißt, der Willkür der Zeit ausgeliefert zu sein. Schwere Kriegserfahrungen saßen in Ihrem Herzen: bei der Flucht aus dem zerbombten Keller in Frankfurt hatte sie ihren den Bruder verloren.
Und doch war in ihr etwas geblieben, das dem Leben trotzte – eine Energie, die sich Bahn brach in der Bewegung, im Lauf, im Sprung.
Sechsundzwanzigfache hessische Meisterin wurde sie, und was bei anderen nur Ehrgeiz gewesen wäre, war bei ihr ein Akt der Selbstbehauptung. Sie führte, organisierte, prägte die Leichtathletik der Eintracht, später auch des Verbandes, mit derselben unbeirrten Klarheit, mit der sie einst über die Aschenbahn gelaufen war. Schließlich ehrte sie das Internationale Olympische Komitee mit der Auszeichnung „Women and Sport Trophy“, die nicht allein sportliche Leistung, sondern Haltung würdigte.
Der Wind glitt über den Stein und ließ einen Halm sich neigen. Man konnte, wenn man wollte, darin den Atem einer Frau spüren, die dem Leben in seiner ganzen Schwere begegnet war – nicht verbittert, sondern geläutert. Ein leises Gefühl von Dankbarkeit blieb zurück, das sich schwer in Worte fassen ließ.

Albert Wamser (4.8.1863 – 16.5.1930)
Einige Schritte weiter, dort, wo die Baumkronen ein Gewölbe aus Dunkel und Licht bildeten, lag die Grabstätte Albert Wamsers. Der Regen hatte eine Pause eingelegt, und in der feuchten Luft hing der Geruch von Erde, Metall und welkendem Blatt. Der Ort war still, doch nicht tot – vielmehr von jener schweren, ehrwürdigen Ruhe erfüllt, die alten Dingen eigen ist, deren Bedeutung im Schweigen fortlebt.
Albert Wamser war einer jener frühen Männer, die den Fußballsport aus der Unbestimmtheit des Liebhabertums in die Ordnung einer Institution führten. Im Januar des Jahres 1900 hatte er, als Vertreter zweier Frankfurter Vereine (FFC Victoria und FFC 1899), an der Gründung des Deutschen Fußball-Bundes mitgewirkt – ein Augenblick, der in seiner Zeit kaum als historisch erkannt wurde, heute aber die Zukunft des Spiels prägt.
Sein Grab, schlicht und von Efeu halb überwachsen, verriet nichts von diesem frühen Glanz. Ein wenig Prunk, ein bisschen Pathos; Name, Daten, Stein. Und doch schien der Ort eine stille Würde auszustrahlen, als wache etwas Unsichtbares darüber – das Bewusstsein, dass in diesem unscheinbaren Dasein eine Spur jener Aufbruchskraft gelegen hatte, aus der später die großen Erzählungen der Eintracht und des deutschen Fußballs erwuchsen.

Achilles Wild (29.10.1854 – 6.4.1917)
Weiter nördlich, wo die alten Kastanien dichter zusammenstanden und das Licht sich nur gefiltert auf den Boden senkte, ruhte Achilles Wild. Der Name, der wie aus einer anderen Zeit zu stammen schien, trug noch den Klang jener bürgerlichen Heroik, die im neunzehnten Jahrhundert den Sport entdeckte, nicht als Spiel, sondern als Ausdruck moralischer Disziplin.
Achilles Wild war Ruderer gewesen – ein Mann, der sich den Flüssen anvertraute, um gegen sie zu bestehen. Fünfmal errang er die deutsche Meisterschaft, viele Male mehr den Sieg, stets als Einzelner gegen die Macht des Elements. Er war kein Zögling der Schulen oder Vereine, sondern Autodidakt, getrieben von einem inneren Gesetz, das Kraft und Ausdauer forderte.
In alten Berichten ist von einem Rennen die Rede, das bei der Gerbermühle stattfand – ein jener Orte, an denen sich Frankfurts Geschichte und Mythos begegnen. Dort, so erzählt man, hatte Wild den Sieg davongetragen, als wolle er beweisen, dass Wille und Wasser denselben Strom bilden, wenn der Mensch ihnen standzuhalten weiß.
„Wild ist ein so mächtiger Gegner, ein so feingeschulter, fachlich durchgebildeter Sculler, ein so colossal starker Ruderer, ein so wohltrainierter Kämpe, dass wir an seinem Siege nicht im Mindesten zweifeln. (Frankfurter Sportzeitung vom 10. August 1882)
Das Grab, von der Zeit nicht verschont, schien diese Haltung noch zu spiegeln: ein Findling mit Porträtmedaillon des Ruderers sowie dem Wappen der Rudergesellschaft „Germania“. Ein Bild eine Mannes, der sein Werk getan hat.

Albert Pohlenk (12.12.1875 – 4.9.1948)
Wir traten an ein Grab, das ruhig zwischen den höher stehenden Steinen liegt. Albert Pohlenk war einer der Gründer der Eintracht, ein Mann, dessen Wirken nicht nur sportliche Geschichte schrieb, sondern die Stadt Frankfurt in kleinen, beständigen Spuren prägte.
Uhrmacher von Beruf, war er einst auf der Walz durch die Lande gezogen und hatte in Frankfurt Halt gemacht – nicht aus Zufall, sondern aus jener leisen Bindung an Menschen und Orte, die sein Leben bestimmte. Hier eröffnete er einen Laden in der Eckenheimer Landstraße, ein schlichtes Geschäft, das lange Zeit nur wenige wahrnahmen, und doch ein Zentrum kleiner Geschichten und Begegnungen wurde. Die Erinnerung an seinen Namen verschwand nicht gänzlich, auch als das Geschäft die Jahrzehnte überdauerte und erst beim Abbau einer Leuchtreklame wieder ans Licht kam.
Sein Leben war ein Zeugnis davon, dass Größe oft unspektakulär beginnt, in kleinen Schritten, in stiller Beharrlichkeit.

Fritz Becker (13.9.1888 – 19.2.1963)
Wir traten an ein schlichtes Grab, das sich zwischen höheren Steinen erhob. Fritz Becker, Bockenheimer von Geburt, war einer jener Spieler, deren Wirken die frühe Geschichte des Fußballs in Frankfurt maßgeblich prägte. Er gehörte zum FC Germania 1894 und später zu den Frankfurter Kickers die danach in der Frankfurter Eintracht aufgingen.
Am 5. Mai 1907 empfing eine Frankfurter Stadtauswahl auf dem Hermannia-Platz im Ostpark den amtierenden englischen Ligameister Newcastle United. Die Frankfurter Kickers wurde dabei von ihrem Sturmtrio Bertrand, Fritz Becker und Fay vertreten. Das Spiel endete 6:2 für Newcastle, beide Frankfurter Tore erzielte Becker.
Er war es, der auch das erste Länderspieltor für Deutschland schoß. Es wird berichtet, dass das Spiel 3:5 verloren wurde, aber nur Fritz Becker kannte die Wahrheit und erzählte Zeit seines Lebens, dass es 2:5 verloren wurde und er beide Tore schoß. Seine letzten Tore für die Eintracht schoß er in der Saison 1920/21, die mit der Meisterschaft der Kreisliga Nordmain endete.
Sein Leben war durchzogen von Talent, Mut und Beständigkeit. Auch nach seiner aktiven Zeit blieb er der Eintracht verbunden, als Ehrenspielführer, Symbol der Kontinuität und der stillen Größe. Vor seinem Grab wirkte dies besonders deutlich: ein Ort der Ruhe, in dem Leistung und Erinnerung gleichsam fortbestehen, unaufdringlich, aber dauerhaft in seiner Familie und in der Geschichte der Stadt verankert.

Helmer Boelsen (13.1.1925 – 30.9.2015)
Ein Stück weiter lag Helmer Boelsen, dessen Grab von alten Linden beschattet wurde. Boelsen war kein Spieler, doch sein Werk war ein Fundament der Erinnerung: als Sportredakteur bei der Rundschau begleitete er über Jahrzehnte Radsport und Fußball, schrieb Bücher, bewahrte Geschichten und machte den Sport für die Öffentlichkeit lebendig.
Sein Auge für das Detail, seine Leidenschaft für die Bewegung, waren ebenso prägend wie sein Einfluss auf den Radsport, wo er sich den Ruf eines „Radsportpapstes“ erworben hatte. Über Jahre hinweg betreute er die Pressearbeit beim Henninger-Turm-Rennen, gestaltete die Berichterstattung, bewahrte Erfolge und Niederlagen und gab dem Sport einen Raum, der weit über die Tagesereignisse hinausreichte.
Das Grab, mit einer Würde, die man nicht übersehen konnte, vermittelte diese stille Größe. Helmers Leben war ein Zeugnis dessen, dass Einfluss nicht allein durch körperliche Taten entsteht, sondern auch durch Beobachtung, Wort und Hingabe. Wer hier verweilte, spürte die Nachwirkung seiner Arbeit, die nicht im Rampenlicht, sondern in den Köpfen und Erinnerungen weiterlebte, wie ein leiser, fortdauernder Pulsschlag zwischen den alten Bäumen des Friedhofs.

Georg „Schorsch“ Poth (12.7.1914 – 19.9.1964)
Wir gelangten zu einem Grab, das sich zwischen höheren Monolithen versteckte, fast schüchtern, und doch von einer eigentümlichen Präsenz erfüllt war. Hier ruht Georg Poth, genannt Schorsch, ein Mann, der nie selbst Spieler der Eintracht war, aber dessen Leben untrennbar mit dem Verein verwoben war.
Sein Platz war auf den Rängen, inmitten der Fans, deren Leidenschaft er teilte und verstärkte. Auf alten Filmaufnahmen der Meisterschaft 1959, beim Spiel in Glasgow, sieht man ihn mit erhobenen Bannern, die den Gruß seiner Heimat trugen, auf dem Rasen. Doch Schorsch war nicht nur Enthusiast, sondern auch Handwerker: als Malermeister verputzte er die Tribüne im Riederwald, damit der Sieg in gebührender Umgebung gefeiert werden konnte.
Sein Tod kam auf dem Nachhauseweg nach einer bitteren Niederlage, und man kann der stillen Luft fast den Nachhall seiner Emotionen und seines Engagements spüren. Schorsch lebte die Eintracht in jeder Faser, und das Grab, schlicht und zurückhaltend, vermittelt eine stille Würdigung eines Mannes, der sein Herz dem Verein verschrieben hatte. Die Bäume über ihm, die ihre Blätter zu ihm schicken, scheinen die Echos der Schlachten auf dem Rasen zu tragen, den Jubel der Fans und das leise Rufen eines Lebens, das in Hingabe aufgegangen war.

Dr. Runzheimer (1914 – 1993)
Unter den schattigen Bäumen ruht Dr. Runzheimer, der Mann, der die Spieler der Eintracht nicht auf dem Feld, sondern in ihrer körperlichen Integrität begleitete. Als Mannschaftsarzt der Meister- und Europapokalmannschaften wirkte er im Hintergrund, unsichtbar und doch unverzichtbar.
Neben seiner Fürsorge für andere war er selbst Teil der sportlichen Bewegung, sichtbar im Leben seiner Frau Doris, über 80 Hürden 1936 deutsche Meisterin und sechste Im Finale bei den olympischen Spielen 1936 in Berlin.
Das Grab wirkte wie er selbst und in der stillen Umgebung des Friedhofs wurde deutlich, dass Runzheimer seine Wirkung in der Fürsorge und Präzision entfaltet hatte – ein Mann, dessen Arbeit durch Wirkung in anderen Menschen erinnert wird.

Richard Kress (6.3.1925 – 30.3.1996)
Wir erreichten ein Grab zwischen alten Linden, schlicht und doch sorgfältig gearbeitet. Richard Kress, geboren in Fulda und dort bekannt als der „Blitz von Horas“, war ab 1953 Spieler der Eintracht, Mitglied der Meistermannschaft.
Er erzielte im denkwürdigen Europapokalendspiel gegen Real Madrid das 1:0. Leider hilt das nur 20min, zur Halbzeit stand es 4:1 und am Ende 7:3 für Real – im „Spiel des Jahrhunderts“
Beim Bundesligastart 1963 mit Eintracht Frankfurt war er dabei und ist bis heute der älteste „Neuling“ in der Liga. Er war auch Nationalspieler, das 1:0 gegen Nordirland am 10.Mai 1961 war seines, da war er 36 Jahre alt und ist bis heute der älteste Debüt Torschütze Deutschlands
Sein Leben verband Sport, Stadt und alltägliche Arbeit in seiner Drogerie im Oeder Weg auf harmonische Weise, wodurch seine Präsenz über das Spielfeld hinaus wirkte.
Kress zeichnete sich durch Ausdauer und Ruhe aus: er hinterließ damit ein Bild von Erfahrung, Können und ungebrochener Leidenschaft. Das Grab, das heute ehrfurchtsvoll vom Eintracht Museum gepflegt wird, vermittelte den Eindruck, dass Erfolg nicht immer laut verkündet werden muss – seine Spuren waren leise, aber beständig, sowohl in der Stadt als auch im Gedächtnis derer, die auf den Wegen des Friedhofs wandelten.

Hermann Höfer (1934 – 1996)
Wir traten auf ein Grab zu, das sich bescheiden zwischen Büschen und Steinen befand. Hermann Höfer, Verteidiger der Eintracht, gehörte zur Meistermannschaft von 1959 und hatte sich durch Beständigkeit und Pflichtbewusstsein ausgezeichnet, die ihn zu 224 Spielen und 17 Toren verhalfen.
Er war auch Olympionike, als Teilnehmer bei den Olympischen Spielen 1956 in Melbourne, das Team schied aber nach einem 1:2 gegen die Sowjetunion nach dem ersten Spiel aus.
1957 wurde der Deutscher Flutlichtpokalsieger, ein Titel, von dem heute keiner mehr weiß was das ist.
Ein persönlicher Gedanke trat mir auf: Als Kind, im Urlaub in der Lüneburger Heide, hatte ich mit meinem Vater auf einem Bauernhof gewohnt – und der große Hermann Höfer hat auf diesem Hof mit dem Knirps Kalles einfach Bälle hin- und her geschossen. Diese Vorstellung verband mich mit dem Verstorbenen auf leise, beinahe poetische Weise. Das Grab strahlte Ruhe und Würde aus, und in der Bewegung des Windes durch die Blätter lag ein Sinnbild für die flüchtigen Momente, in denen Erinnerung, Leistung und Vergänglichkeit aufeinandertreffen.
Wir wanderten die letzten Wege des Hauptfriedhofs entlang, wo die Alleen sich lichteten und das Tageslicht in breiten Streifen zwischen die Baumkronen fiel. Stille lag über allem, eine Stille, die nicht leer war, sondern erfüllt von den Stimmen der Vergangenheit, von den Erinnerungen an jene, deren Leben wir auf dieser Führung berührt hatten.
Die Gräber, von Schlichtheit ebenso geprägt wie von Würde, standen wie stille Zeugen einer Zeit, in der Leidenschaft, Pflichtbewusstsein und Tatkraft noch in den kleinen und großen Gesten des Alltags lebten. Jeder Stein, jede Inschrift erzählte von Menschen, die ihre Spuren in der Eintracht und in Frankfurt hinterlassen hatten – von Ilse Bechthold, über Albert Wamser, bis zu Richard Kress und Herrmann Höfer.
Es war eine Wanderung durch die Zeit, bei der die Natur selbst zu einem Teil der Erzählung wurde: der Wind, der in den Blättern rauschte, die alten Bäume, die Schatten auf die Wege warfen, und das Licht, das den Steinflächen einen flüchtigen Glanz verlieh. All dies verband sich zu einer leisen Erinnerung daran, dass Größe nicht immer im Rampenlicht liegt, sondern oft in der beständigen, unspektakulären Hingabe.
Als wir schließlich das Ende des Friedhofs erreichten, blieb ein Nachklang in der Luft, wie ein leiser Atem, der die Geschichten noch einmal zusammenfasste. Die Eintrachtler hatten ihren Platz in der Vergangenheit gefunden, doch durch die Erinnerung, die Erzählung und die Stille des Ortes lebten sie weiter – nicht als bloße Namen, sondern als Sinnbilder von Leidenschaft, Beständigkeit und menschlicher Größe.
Und so verließen wir den Friedhof, durchzogen von einem stillen Respekt, der sich nicht in Worten ausdrücken ließ, sondern nur in dem leisen Wissen, dass die Geschichte hier nicht endet, sondern in den Herzen derer fortbesteht, die sich erinnern.
… und noch ein paar Links:
Frankfurter Rundschau, Hessischer Rundfunk, Eintracht Museum
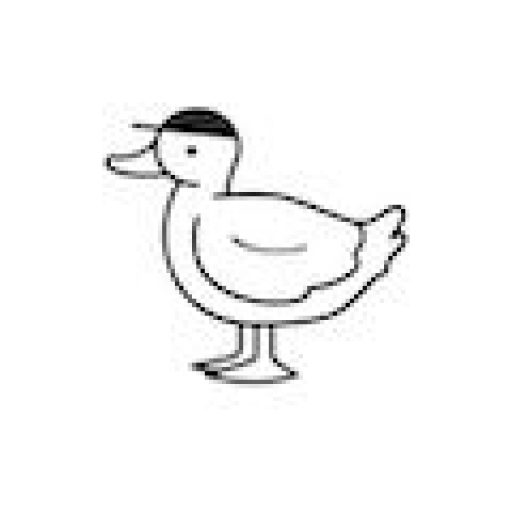
Was ein berührender Bericht! Und dann noch die Anekdote mit dem Kicken mit Hermann… grandios!
Danke Kalles von einer Frankfurterin in der Diaspora am Bodensee, aber auch lebenswert. Die Idee und der Wort- und Bildbericht begeistern mich. Ein Frankfurt-Feeling der feinsten Art aus der Fussballperspektive und dem wehmütigen Charme der Vergangenheit.